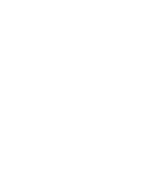 Gärten
Gärten
Ein Garten kann für viele Arten ein vorübergehender Aufenthaltsort sein und dabei Nahrung bereitstellen, zum Beispiel in Form von Blütenpollen und -nektar für Wildbienen, Käfer, Schmetterlinge und Schwebfliegen. So ermöglicht ein Garten die Ausbreitung und Ernährung von Arten, die dann allerdings nur wie Touristen vorbeiziehen.
Wo aber finden diese Arten einen Lebensraum, in dem sie sich entwickeln und fortpflanzen können? Was passiert mit den Zweigen an den Büschen und Bäumen, an denen die Eier einiger Tagfalterarten überwintern? Wie verfahren wir mit dem Staudenbeet im Herbst, in dem sich Larven und Puppen zur Überwinterung eingerichtet haben? Wann bearbeiten wir den Boden, in dem die meisten unserer einheimischen Wildbienenarten nisten? Nicht immer findet eine Art alles, was sie im Laufe ihres Lebens benötigt, in einem einzigen Garten. Aber Insekten sind mobil und wenn ihre unterschiedlichen Anforderungen in einem Verbund aus Gärten erfüllt werden, finden viele Arten in diesem Mosaik Lebensräume, in denen sie sich fortpflanzen und entwickeln können.
Lebensraum Garten

In der Geschichte der Menschheit spielen Gärten eine existenzielle Rolle für unsere Ernährung und unsere Gesundheit. Hier werden Gemüse, Obst, Heil- und Gewürzpflanzen in Kultur genommen. In Phasen zunehmenden Wohlstands gesellen sich Blumen-, Landschafts- und Naturgärten sowie Botanische Gärten hinzu, die alle zu unserem Wohlbefinden beitragen und so für unsere physische und mentale Gesundheit unerlässlich sind. Gärten weisen einen hohen Grad an individueller Gestaltung auf.
Die meisten Gärten werden privat genutzt. In Deutschland gibt es 17 Mio. Privatgärten mit einer Gesamtfläche von 680.000 ha, was knapp 2 % der Landesfläche entspricht. In Sachsen umfassen allein die Kleingärten 9.000 ha, hinzu kommen die vielen Hausgärten. Aufgrund ihrer verstreuten Lage im Siedlungsbereich können Gärten ein Lebensraum-Netzwerk für viele einheimische Arten bilden. Bislang aber fehlen in Gärten oft Strukturen, die Artenvielfalt fördern. Gar keinen Lebensraum bieten gepflasterte Höfe, Schottergärten und kurzgeschorene Rasenflächen.
Welches Potential Gärten für die Artenvielfalt aufweisen können, zeigt ein Beispiel aus England. Dort hat Jennifer Owen in ihrem 741 m² großen Garten innerhalb von 30 Jahren (1972 – 2001) 1.997 Insektenarten nachgewiesen. Je nach Artengruppe fand sie in ihrem Garten zwischen 5,6% (Ameisen) und 54,2% (Marienkäfer) der Arten der gesamten britischen Fauna.
So förderst du Insekten im eigenen Garten
Standort
Jeder Garten hat ganz konkrete Standortbedingungen. Dies betrifft die Bodenart wie Sand oder Lehm, die Versorgung mit Wasser über den Niederschlag und die Wasserhaltefähigkeit des Bodens sowie die Lichtverhältnisse von schattig bis sonnig. Diese Bedingungen können schon innerhalb eines Gartens sehr unterschiedlich sein und entsprechend wird nicht jede Pflanze an jeder Stelle im Garten wachsen können.
Viele Gärten werden seit Generationen bewirtschaftet. Durch Einbringung von Pflanzenresten, Stallmist und Kompost hat sich über lange Zeiträume ein dunkler, fruchtbarer Boden entwickelt, in dem eine große Menge an Bodenorganismen leben. Er wird auch als Mutterboden bezeichnet und ist in vielen Kulturen Sinnbild für die Fruchtbarkeit und das Leben. Diese Fruchtbarkeit zu bewahren und zu mehren übernehmen wir von unseren Vorfahren und geben an unsere Nachfahren weiter.
Torf oder torfhaltige Erde sollten nicht verwendet werden. So lange Torf in einem intakten Moor verbleibt, bindet er Kohlenstoff. Beim Abbau von Torf werden wertvolle Lebensräume für Pflanzen, Tiere und Pilze zerstört. Außerdem wird gespeicherter Kohlenstoff an der Luft oxidiert und dadurch wird das Treibhausgas Kohlendioxid in beträchtlichen Mengen in die Atmosphäre abgegeben.
Kräuter und Stauden
Zierpflanzen verwenden, die keine gefüllten und sterilen Blüten haben. Die Blüten vieler Zierpflanzen können Pollen und Nektar für zahlreiche einheimische Insektenarten liefern, wenn sie ungefüllt und nicht steril sind! Echter Lavendel (Lavandula angustifolia) VI–VII, Wilde Karde (Dipsacus fullonum) VII–VIII, Purpur-Sonnenhut (Echinacea purpurea) VII–IX, Gewöhnliche Stockrose (Alcea rosea) VII–IX, Zinnie (Zinnia elegans) VII–X und Neubelgische Aster (Symphyotrichum novi-belgii) IX–X sollen hier nur stellvertretend für viele weitere geeignete Pflanzenarten genannt werden. Die römischen Zahlen geben die Monate an, in denen die genannten Zierpflanzen blühen. Dies zeigt, dass schon mit wenigen Arten ein Blütenangebot über die gesamte Vegetationsperiode geschaffen werden kann.
Einheimische Pflanzenarten im Garten ergänzen. Nicht in jedem Fall stellen Zierpflanzen auch die Nahrung für die Larven jener Arten, deren Adulte an den Blüten Nektar saugen oder Pollen aufnehmen. Um auch die Grundlage für diesen wichtigen Abschnitt in der Entwicklung von Insekten zu schaffen, benötigen viele Insekten vor allem einheimische Pflanzenarten. Von diesen stellen allein Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia) VI–IX, Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus) V–VIII und Gewöhnliches Bitterkraut (Picris hieracioides) VII–X jeweils den Pollen für die Larven von wenigstens 10 spezialisierten Wildbienenarten bereit. Der Echte Dost (Origanum vulgare) VII–VIII blüht im Hochsommer und lockt zahlreiche Insekten zum Blütenbesuch an.
Eine Übersicht über Bezugsadressen für Wildpflanzen in Sachsen findest du hier.

Gehölze im Garten
Einheimische Bäume und Sträucher pflanzen. Bäume und Sträucher erhöhen den Strukturreichtum und die Vielfalt unterschiedlicher mikroklimatischer Bedingungen im Garten. Zudem sind viele typische Gartengehölze ursprünglich in unserer Natur zu Hause und deshalb Nahrungsgrundlage für viele einheimische Insekten. An Kirschen und Pflaumen leben 448 Insektenarten, an Äpfeln 243, an Wildrosen 203, an Brom- und Himbeeren 183, an Birnen 168 sowie an Stacheln- und Johannisbeeren 55 Insektenarten. Ein Garten mit Obstgehölzen und Wildrosen kann also einer ganzen Reihe einheimischer Insektenarten einen Lebensraum bieten. Mehr über Bäume erfährst du hier.
Dieses Spektrum kann noch erweitert werden, wenn entlang von Grundstücksgrenzen keine Zäune gebaut, sondern Hecken gepflanzt werden. Hecken sind durchlässig für Tiere wie den Igel, Bruthabitat für Singvögel wie die Amsel und Nahrungsgrundlage für viele Insektenarten, wenn es sich um einheimische Gehölze wie Hainbuche, Hasel, Liguster und Weißdorn handelt. Wichtig ist, dass Hecken nur außerhalb der Vegetationsperiode geschnitten werden, also wenn die Büsche keine Blätter tragen und keine Vögel in der Hecke brüten.
Pflanzenschutz
In einem Garten für die Artenvielfalt sollten keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Der Grund dafür ist ihre Funktionsweise. Die Wirkstoffe in den Pflanzenschutzmitteln töten Leben: Insektizide töten Insekten, Herbizide töten Pflanzen, Fungizide töten Pilze, Molluskizide („Schneckenkorn“) töten Schnecken usw. Für die allermeisten Pflanzenschutzmittel gilt, dass sie recht unspezifisch wirken. So wirken die meisten Insektizide auf alle Insekten, mit Ausnahme biologischer Präparate wie Bacillus thuringiensis, die je nach Stamm alle Schmetterlinge oder alle Fliegen, einschließlich Schwebfliegen töten. Schneckenkorn ist tödlich für alle Schnecken, nicht nur für die Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris). Die effizienteste Maßnahme gegen die Spanische Wegschnecke im Garten ist ohnehin nicht das „Schneckenkorn“, sondern das Absammeln der Spanische Wegschnecke.
Wer die ‚Guten‘ haben möchte, braucht dafür die ‚Schlechten‘. Im Garten können viele einheimische und auch seltene Schneckenarten vorkommen, die der Spanischen Wegschnecke Konkurrenz machen und der Tigerschnegel (Limax maximus) verspeist diese sogar gelegentlich. Auch Amseln, Igel und Laufkäfer ernähren sich teilweise von Schnecken, die Larven des Glühwürmchens und des Großen Leuchtkäfers sind sogar auf Schnecken spezialisiert. Die Larven von Schwebfliegen und Florfliegen fressen Blattläuse. Bei vielen Marienkäferarten machen dies nicht nur die Larven, sondern auch die Adulten. Und viele Schlupfwespen legen ihre Eier in den Larven anderer Insektenlarven ab, die sich dann auf deren Kosten entwickeln. All diese natürlichen Gegenspieler gibt es im Garten. Allerdings nur so lange, wie es ihre bevorzugten Wirtstiere gibt. Es kommt also darauf an, potentiell schädliche Tiere aus dem Garten nicht vollständig zu entfernen. Ohrwürmer beispielsweise sitzen tagsüber an geschützten Stellen in Bodennähe. Nachts begeben sie sich auf die Obstbäume, wo sie sich von Blattläusen ernähren und deren Anzahl beträchtlich reduzieren.
Pflanzen können sich wehren. Pflanzen besitzen sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, mit denen sie sich gegen Fressfeinde schützen. Solche Inhaltsstoffe können unappetitlich oder sogar giftig sein. Ein Beispiel dafür sind die Senfölglykoside der Kreuzblütengewächse, zu denen der Kohl (Brassica oleracea) mit seinen vielen Kultursorten gehört. Viele Pflanzenfresser meiden diese Pflanzen aufgrund der Senfölglykoside, aber für uns Menschen werden sie dadurch erst besonders schmackhaft. Genauso geht es den Raupen der Kohlweißlinge. Man kann sie im Garten einfach absammeln. Zudem reagieren Pflanzen auf Insektenfraß mit chemischen Botenstoffen, die Schlupfwespen und räuberische Insekten anlocken sowie benachbarte Pflanzen dazu anregen, selbst mehr sekundäre Inhaltsstoffe zu produzieren
Pflanzpläne zum Download
Sonniger Standort
Beispielbepflanzung für normalen Gartenboden, sonnig, berechnet für 15m² (Download)
Schattiger Standort
Beispielbepflanzung für normalen, humosen Gartenboden schattig, eher trocken, berechnet für 15m²
(Download)
Feuchter Standort
Beispielbepflanzung für feuchte Gartenecken, Regenwasserversickerung, Gräben, o.ä. sonnig bis halbschattig, frisch bis feucht, nährstoffreich, berechnet für 15 m²
(Download)
Magerer Standort
Beispielbepflanzung für mageren Boden / mineralisches Substrat sonnig, trocken, nährstoffarm, berechnet für 15 m²
(Download)
Literatur
- Brumm, T. 2023: Die Vielfalt der Arten im Kleingarten. – Gartenfreund Nr. 4, 2023: 26–27.
- Dehnhardt, A., M. Welling, L. Laug & D. Jakubka 2021: Biologische Vielfalt in Privatgärten. Welche Faktoren die Gartengestaltung beeinflussen. – Diskussionspapier des Instituts für Ökologische Wirtschaftsforschung, Berlin 73/21: 48 S.
- Meerheim, F. & M. Nuß 2020: Auswahlkriterien für Pflanzenarten zur Förderung sächsischer Wildbienen und Ableitung einer Pflanzenartenliste. – Sächsische entomologische Zeitschrift 10: 99–108 + elektronisches Supplement.
- Thompson, K. 2006: No nettles required. – Eden Project Books, Cornwall, UK. 174 S.
- Owen, J. 2010: Wildlife of a garden. A thirty-year study. – Royal Horticultural Society, London. XV+261 S.
Links
- Kleingärten für Biologische Vielfalt https://kleingaerten-biologische-vielfalt.de/

„Natur vor der eigenen Haustür – Mach mit!“
Du möchtest Dich aktiv für Insekten engagieren? Registriere Dich, erstelle einen Lebensraum mit verschiedenen Requisiten (Hecke, Bäume, Wiese, Garten, Gewässer, Gebäudebegrünung) und pflege diesen insektengerecht. Für Deinen Lebensraum kannst du einen Blog führen, Fotos hochladen und Insektenfunde melden, so dass jeder die Vielfalt Deines Lebensraums sehen kann. Klick auf den Button und mach mit!


